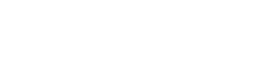Nanomembranen als Virenfilter
Dünne Folien im Kampf gegen Corona

Der Auslöser der aktuellen Pandemie ist winzig. Mit einem Durchmesser von etwa 120 Nanometern ist das Coronavirus Sars-CoV-2 mehrere hundert Male kleiner als die Poren eines Baumwollstoffs. Selbstgenähte Gesichtsmasken schützen daher nur bedingt vor den Krankheitserregern. Die Membranen hingegen, die ein von TU-Professor Wolfgang Ensinger geleitetes Team herstellen, sind absolut virendicht. Sie bestehen aus hauchdünnen Folien mit Nanoporen. Viren passen nicht durch die kleinen Löcher – Luft, Wasser und andere kleine Moleküle hingegen schon.
Kann das Material als Filter gegen Coronaviren dienen? Dieser Frage gehen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler jetzt nach. Mit Nanopartikeln aus Siliziumdioxid haben sie die Filterkraft schon getestet. „Die Membran arbeitet höchst zuverlässig“, sagt Ensinger. Allerdings müsse bedacht werden, dass die Modellpartikel sehr steif seien, während Viren eine gewisse Flexibilität besäßen: „Damit die Krankheitserreger nicht durchschlüpfen, sollte der Durchmesser der Nanoporen deutlich unter dem der Viren liegen.“ In dem Modellversuch wurden Folien mit Porendurchmessern von 60 Nanometern verwendet.
Bei der Entwicklung der Membranen arbeitet Ensingers Team eng mit Materialwissenschaftlern vom GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung in Darmstadt zusammen. Dort werden die Nanoporenmembranen mit einem Verfahren namens Ionenstrahlätzung hergestellt. Die Technik ist in Deutschland nur am GSI möglich, denn sie erfordert eine Beschleunigungsanlage, die Ionen mit extrem hoher Energie auf eine Folie aus Kunststoff schießt. Beim Durchtritt durch die Folie zerstören die Ionen chemische Bindungen und hinterlassen geradlinige Spuren. Aus diesen Schadspuren lassen sich anschließend mit Natronlauge feine Kanäle ätzen.
Die Ionenstrahlätzung ist zwar aufwendig, aber durchaus industrie-tauglich: Ein kommerzieller Hersteller von Filtermaterialien produziert damit bereits Membranen für die Aufbereitung von Blutproben. Polycarbonat-Folien von der Rolle werden dafür erst durch den Beschleuniger gezogen, der sie mit Argon-Ionen beschießt, und dann durch das Ätzbad.
Das Team der TU Darmstadt verwendet den extrem stabilen und hitzeresistenten Kunststoff Polyimid. Für dessen Durchlöcherung muss die Gruppe härteres Geschütz auffahren: Statt mit leichten Argon-Ionen beschießt sie ihre Folien mit schweren Gold-Ionen. Auch dieses Verfahren sei kommerzialisierbar, wenn sich ein Markt ergebe, betont Ensinger. Er denkt bei Anwendungen vor allem an Luftfiltersysteme, etwa für Virenlabore oder Quarantänestationen in Kliniken.
Für Schutzmaskeneignen sich die Membranen bislang nicht, da sie nur zu zehn Prozent aus Nanoporen bestehen und zu wenig Luft zum Atmen durchlassen. Man müsste die Folie für diesen Zweck stärker perforieren – doch dann besteht das Risiko, dass die Poren zu größeren Löchern überlappen und Viren nicht mehr stoppen. „Das ist eine technische Optimierungsfrage, eine Abwägung zwischen dem Luftdurchsatz und der Häufigkeit von Porenclustern“, sagt Ensinger. Man darf gespannt sein, ob das Vorhaben gelingt. An mangelndem Bedarf für virenundurchlässige Membranen sollte es jedenfalls nicht scheitern.
LOEWE-Schwerpunkt iNAPO
Im LOEWE-Schwerpunkt iNAPO, der zum Zentrum für Synthetische Biologie an der TU Darmstadt gehört, statten Wolfgang Ensinger und seine Kollegen und Kolleginnen Nanoporenmembranen mit Erkennungselementen aus, um Biomoleküle zu identifizieren. Dieses Konzept möchten sie jetzt auf die Detektion von Viren oder Antikörpern ausdehnen. Dafür streben sie eine Kooperation mit Fachleuten aus der Virologie an. Mehr Informationen zu iNAPO