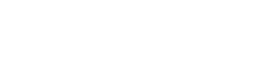Darf's ein bisschen kleiner sein? | Nachbericht zur „Beyond Elements“-Veranstaltung am 15. Januar 2025
Würden nicht in jeder Sekunde weltweit Milliarden von Mikrochips ihren Dienst tun, käme die Welt zum Stillstand. Kommunikation, Mobilität, Energieerzeugung, Medizin, Industrieproduktion – ohne leistungsfähigen digitalen Unterbau ist moderne Technologie schlicht nicht denkbar. Der Halbleitermarkt wird daher weiter wachsen: laut Marktforschern von derzeit etwa 600 Milliarden auf 1.000 Milliarden Dollar bis 2030.
Ein Akt für eigene Halbleiter
Gut, wenn man da mit im Spiel ist. Derzeit aber sind Europa und Deutschland im Halbleitermarkt eher Zuschauer als aktive Player. Die EU hat einen Anteil von acht bis zehn Prozent an der globalen Chipproduktion. Der Markt ist seit langem fest in asiatischer Hand.
Das würde die EU gerne ändern und hat einen Chips Act verabschiedet. Das Gesetz soll Versorgungsschwierigkeiten bei Halbleitern abwehren und den europäischen Anteil am Halbleitermarkt bis 2030 auf 20 Prozent verdoppeln. IT-Verbände, Mitgliedsstaaten und EU-Kommission haben das „Gemeinsame Unternehmen für Chips“ (Chips JU) gegründet, um erste Pilotlinien an den Start zu bringen. „Sie werden die komplette Prozesskette vom Design bis zum Chip abbilden und eine Brücke zwischen Labor und Produkt schlagen“, sagt Dr. Steffen Uredat, Berater IT bei der VDI/VDE Innovation und Technik GmbH in Berlin. Insgesamt soll das Gesetz Milliarden an öffentlichen und privaten Investitionen ankurbeln.
2024 wurden vier transnationale Konsortien und Pilotlinien ausgewählt, die für insgesamt viereinhalb Jahre Fördermittel erhalten. Aus Deutschland beteiligen sich elf Fraunhofer- und zwei Leibniz-Institute an der APECS-Pilotlinie. APECS steht für „Advanced Packaging and Heterogeneous Integration for Electronic Components and Systems“ und setzt Schwerpunkte auf die sogenannte Heterointegration und auf neue Chiplet-Technologien. Ziel ist es, durch Kombination mehrerer Chips in einem Baustein und durch modulares und teilweise standardisiertes Design mehr Funktionalitäten zu schaffen und die Leistung zu steigern.
1.200 Schritte machen einen Chip
Ein Gesetz ist vergleichsweise schnell zu Papier gebracht, vor allem, wenn es um entscheidende Technologie wie Halbleiter geht. Die Umsetzung steht auf einem anderen Blatt: Da der Halbleiterbedarf von Jahr zu Jahr wächst, braucht Europa für den angestrebten Eigenanteil von 20 Prozent am Weltmarkt zahlreiche neue Standorte, Anlagen, Fabriken und vor allem auch die dafür notwendigen Fachkräfte. Und sehr viel Geld: Eine einzelne hochmoderne Anlage, die auf Mikrochips Strukturen von wenigen Nanometern erzeugen kann, kostet etwa 350 Millionen Euro, eine ganze Halbleiterfabrik 15 bis 20 Milliarden Euro. „Der Chips Act ist also ein sehr ambitioniertes Unterfangen“, urteilt Uredat.
Mikrochips gehören zu den kompliziertesten Produkten, für die jemals eine Massenfertigung aufgebaut wurde. „Ein Chip durchläuft etwa 1200 Schritte und die Prozessierung eines Wafers dauert drei Monate“, sagt Prof. Dr. Peer Kirsch, Scientific Director bei der Merck KGaA in Darmstadt. Strukturen auf Hochleistungschips sind nur noch wenige Nanometer groß, also nicht mehr als einige Atomlagen. Die Fertigung findet unter Reinraumbedingungen statt, da schon vereinzelte Fremdmoleküle die Oberfläche kontaminieren können. Außerdem muss bei der hohen Zahl an Prozessschritten die Präzision jedes einzelnen Schritts bei nahe hundert Prozent liegen, damit am Ende der Ausschuss klein bleibt.
Hightech im Mikrokosmos
Die winzigen Strukturen entstehen in der Regel durch Photolithografie, bei der die Schicht eines lichtempfindlichen Polymers über eine Maske partiell belichtet wird. Teile davon werden entfernt und öffnen die Chipoberfläche für die weitere Bearbeitung, zum Beispiel das Einbringen von Dotierelementen oder für Ätzprozesse zur Herstellung von Vertiefungen. Nanometer-kleine Strukturen entstehen heute durch extrem kurzwelliges UV-Licht.
Alternativ können auch chemische Methoden periodische Muster auf einem Chip erzeugen. Das gelingt beispielsweise mit Blockpolymeren, die bei Erwärmung zwei Phasen mit unterschiedlichen Eigenschaften ausbilden. Wird eine Phase entfernt und die Oberfläche durch weitere Prozessschritte behandelt, entstehen regelmäßige Muster. Diese chemische Variante hat zwar keine so gute Auflösung wie die Lithografie. Ein großer Vorteil aber ist laut Kirsch, dass sie auf preisgünstigeren Anlagen älterer Bauart funktioniert.
Speziell für die Herstellung von Flashmemorychips – Speicher, die elektrisch gelöscht und neu programmiert werden können – oder von tief liegenden Strukturen in Silizium eignet sich das Reaktiv-Ionen-Ätzen. Dabei wird ein chemisch reaktives Plasma im elektromagnetischen Feld beschleunigt. Es entstehen hochenergetische Ionen, die auf Wafern abgelagertes Material entfernen oder Öffnungen in die Oberfläche ätzen. Vielfach enthalten Ätzgase allerdings fluorhaltige Chemikalien mit hoher Treibhausgasintensität. Sie dürfen daher nicht in die Umwelt gelangen und müssen selektiv aus dem Abgasstrom entfernt werden. Merck hat daher als Sicherheitsfaktor Gase entwickelt, die ebenfalls Fluor enthalten, aber leichter abbaubar sind und nur wenige Tage oder Wochen in der Atmosphäre verbleiben.
KI: Beim Energieverbrauch wenig intelligent
Es hat sich herumgesprochen, dass künstliche Intelligenz beim Energieverbrauch alles andere als intelligent geregelt ist. KI verbraucht etwa zehn Mal so viel Strom pro Rechenleistung wie konventionelle Rechenmethoden. In elektronische Anwendungen geht schon heute etwa ein Zehntel des global erzeugten Stroms, 2030 werden es voraussichtlich 20 Prozent sein. Kirsch: „Das ist ein gewaltiges Effizienzproblem“.
Energetisch hocheffizient arbeitet dagegen das menschliche Gehirn. Seine Energieaufnahme liegt bei einem Millionenstel eines vergleichbaren Supercomputers. Der Grund: Die Neuronen im Hirn legen nicht alle Informationen fest in einem Speicher ab, sondern empfangen, sammeln und senden elektrische Impulse. Erst ab einer bestimmten Impulsschwelle wird ein Neuron selbst aktiv.
Diese neuronalen Systeme technisch nachzubilden gelingt mit sogenannten Crossbar Arrays. Herzstück darin sind Memristoren, die wie mehrere zusammengeschaltete Transistoren fungieren, nur deutlich platz- und energiesparender. Als „lernende“ Widerstände erkennen Memristoren, welche Operationen am häufigsten benötigt werden. Crossbar Arrays können die Rechenleistung neuronaler Netze und damit auch von KI-Systemen beschleunigen. Allerdings benötigen sie für ihre Funktion neuartige Materialien, die seltene Elemente wie Hafnium und Yttrium enthalten.
Gallischer Streit
Wer Halbleiter produzieren will, braucht nicht nur Hightech-Produktionswerke, sogenannte Fabs, sondern auch die Chemie dazu. Gallium, Germanium, Indium, Antimon – zur Rezeptur von Mikrochips gehört eine Reihe chemischer Elemente, die zu den kritischen Rohstoffen zählen, weil sie nur von wenigen Ländern der Welt abgebaut, prozessiert und exportiert werden.
Konflikte um die Stoffe gibt es längst. Ein Beispiel ist der Handelsstreit zwischen China und den USA um Gallium. Als die USA 2022 den Export von Halbleitern aus „Gründen der nationalen Sicherheit“ beschränkten, reagierte China mit dem Exportstopp von Gallium und drohte mit Sanktionen gegen Unternehmen aus Drittstaaten, die fragliche Metalle an US-Abnehmer weitergeben. „Das sorgte für große Unsicherheit im Markt, der Galliumpreis stieg auf das Doppelte“, sagt Jan Giese, Experte für Seltenerdmetalle und Technologiemetalle beim Frankfurter Rohstoffhändler Tradium GmbH.
Zur Panik bei Halbleiterproduzenten allerdings kam es nicht, denn viele haben ausreichend Gallium auf Lager. Giese hat beobachtet: Fällt ein großer Lieferant von kritischen Rohstoffen aus, füllen andere häufig die Lücke, indem sie ihre Bestände auflösen oder das Recycling stärken. Die Empfindlichkeiten bei Abnehmern jedenfalls sind gewachsen. „Viele unserer Kunden wollen keine chinesischen Lieferanten mehr in der Kette“, sagt Dr. Oliver Briel, verantwortlich für Geschäftsentwicklung und Strategie bei Dockweiler Chemicals GmbH in Marburg. Dockweiler produziert unter anderem Spezialchemikalien für die Halbleiterindustrie.
Auch in Zukunft ist mit ähnlichen und neuen Konflikten zu rechnen. Daher, rät Giese, täten EU und Deutschland gut daran, sich auf Engpässe bei strategischen Rohstoffen einzurichten, Reserven aufzubauen und Partnerschaften mit nicht-chinesischen Lieferanten zu schließen.
Germanium aus dem Kongo
Auch für Germanium gelten chinesische Exportbeschränkungen. In Europa produziert und recycelt der belgische Technologiekonzern Umicore Germanium-haltige Materialien. Um die Lieferketten aufrechtzuerhalten, setzt das Unternehmen auf drei Faktoren: das Recycling von Germanium, die Entwicklung von germaniumarmen Materialien, außerdem auf eine strategische Lagerhaltung, um Erschütterungen der Lieferkette abzufedern. Basis für das Recyclinggeschäft sind enge Kundenbindungen. Kunden geben ausgediente oder defekte Produkte an Umicore zurück und erhalten neues Material. Damit sichert sich der Recyclingkonzern den Zugriff auf das Germanium im Altprodukt, das er zurückgewinnt und erneut verarbeitet.
„Bereits heute stammt die Hälfte unserer Germaniumlieferungen aus dem Recycling“, betont Geert Vandenhoeck, Director strategic development bei der international tätigen Umicore Electro-Optic Materials. Diese Aktivitäten sollen ausgebaut werden: Ab diesem Jahr will Umicore gemeinsam mit einer kongolesischen Firma Germanium aus alten Bergbauabfällen in der Demokratischen Republik Kongo gewinnen.
Auf eigene Stärken besinnen
Eine wichtige Säule für mehr Resilienz ist die Stärkung bestehender Standorte und Netzwerke. Einer der größten Player in Deutschland und der EU ist Silicon Saxony, ein in Jahrzehnten gewachsener Branchenverband der sächsischen Mikroelektronik und Softwarebranche mit Schwerpunkt im Raum Dresden. Die Firmen in und um Dresden fertigen bereits heute jeden dritten Mikrochip „made in Europe“. In der Region existieren sieben High-Tech-Fabs, dazu kommen zahlreiche Zulieferer im Umland. Bis 2030 könnte sich die Zahl der Fachkräfte in den Firmen des Netzwerks auf 100.000 summieren. „Die Milliardeninvestitionen für die Halbleiterindustrie in Deutschland sind richtig und wichtig“, ist Stefan Uling, Vizedirektor bei Silicon Saxony e.V. in Dresden, überzeugt.
Förderungen der Halbleiterindustrie sind für den Staat ein lohnendes Investment. Zu diesem Ergebnis kommt auch die im Dezember vorgestellte Studie „Von Chips zu Chancen“ des Verbands der Elektro- und Digitalindustrie ZVEI in Frankfurt/Main. Der Ertrag liegt laut Studie zwischen 30 und 40 Prozent, das eingesetzte Geld amortisiere sich nach neun bis zwölf Jahren. Für die EU haben die Autoren ausgerechnet: Ausgelöst durch die Mikroelektronikförderung unter dem Chips Act steigt die jährliche Bruttowertschöpfung um 33 Milliarden Euro. Dazu kämen 65.000 neue, qualifizierte Arbeitsplätze, davon 49.000 allein in Deutschland.
Mehr Mittel! Mehr Tempo!
Die Studie des ZVEI stellt aber auch fest: Das angestrebte 20-Prozent-Ziel der EU für eigene Halbleiterkapazitäten bis 2030 ist nicht zu erreichen. Vielmehr werde mit den gegenwärtig bereitgestellten Fördermitteln der Anteil von aktuell 8,1 auf 5,9 Prozent im Jahr 2045 sinken. „Europa verfügt nur in den Bereichen Leistungshalbleiter, Mikrocontroller und Sensorik noch über eine starke Marktposition“, sagt Dr. Jonas Gobert aus dem Bereich Mikroelektronik des ZVEI.
Die Antwort darauf liege auf der Hand: weit mehr Fördermittel, weit mehr Tempo, weit mehr Initiative. Zugleich, so Gobert, gelte auch: „Es geht nicht darum, alles selbst zu machen, das käme viel zu teuer.“ Vielmehr komme es darauf an, kritische Kontrollpunkte der Wertschöpfung zu sichern und bestimmte Kompetenzen in der EU zu halten, um bei Handelskonflikten die eigene Verhandlungsposition zu verbessern.
Mit ihrer online-Reihe „Beyond Elements“ richten die drei Veranstalter - Materials Valley e.V, EIT Raw Materials und Technologieland Hessen - den Blick auf eine der wichtigsten Fragen der Zeit: Wie sichern sich EU und Deutschland die Versorgung mit strategisch wichtigen Rohstoffen und stärken ihre Innovationskraft für kommende Technologien? Die letzte Veranstaltung am 26. Februar widmet sich dem Thema Neue Geschäftsmodelle durch Digitalisierung.
Am 30. April findet im Kongresszentrum Hanau die Abschlussveranstaltung in Präsenz statt.
Zur Übersicht der Veranstaltungsreihe